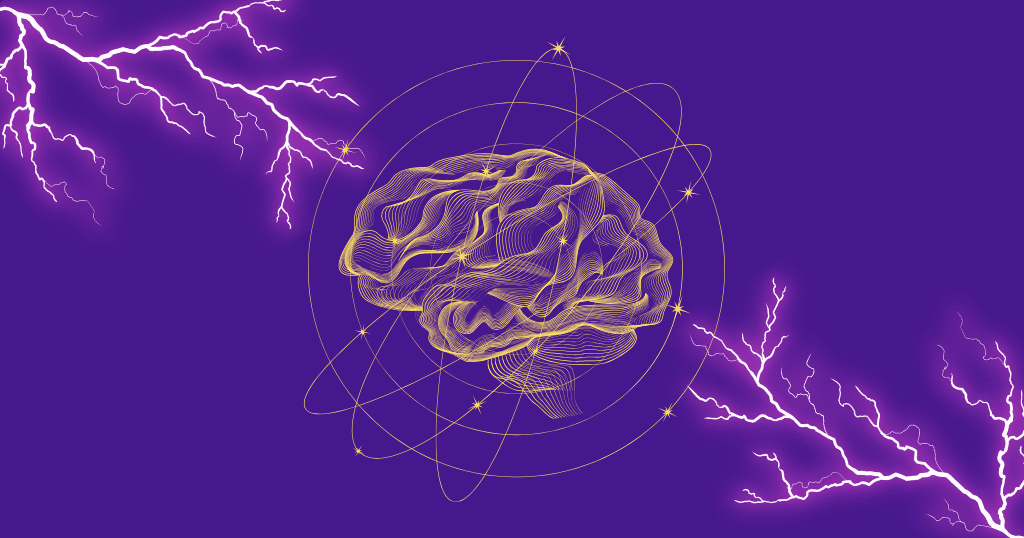Chroniken eines Bildungsprogrammkoordinators – Episode 3
Dieser Artikel ist Teil der „Chroniken eines Bildungsprogrammkoordinators“. In diesem Artikel stelle ich meine persönlichen Ansichten zum Thema „Innovation im Bildungsbereich“ im Allgemeinen dar. Es handelt sich also nicht um eine Inventur sämtlicher Neuheiten aus dem Bereich Pädagogik und Technologie, sondern um meine subjektiven Betrachtungen.
Innovation: für Unternehmen das Gebot der Stunde. Nur gute Arbeit zu leisten und zu liefern, und dies möglichst effizient, das reicht nicht mehr. Nein, heutzutage muss man sich von der Masse der Mitbewerber abheben, „Disruption“ ist angesagt (auch wenn mir dieses Wort – unter uns gesagt – immer noch ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert).
Das alles gilt natürlich auch für den Bildungsbereich.
Denn der Gedanke der „Innovation im Bildungsbereich“ sorgt für Enthusiasmus und regt die Fantasie an. In den letzten Jahren wurden vor dem Hintergrund des technologischen Fortschritts große Reden geschwungen, die mitunter sehr idealistisch klangen, aber trotzdem – wie alle anderen auch – interessengeleitet waren. Es wurde von der Disruption der eigentlichen Lernperspektive gesprochen. Tritt man jedoch einen Schritt zurück, lässt sich feststellen, dass die meisten dieser „innovativen Ansätze“ auf Prinzipien beruhen, die schon sehr lange bekannt sind.
Innovation im Bildungsbereich – eine Illusion
Viele Ansätze, die sich seit einigen Jahren einer gewissen Beliebtheit erfreuen, sollen unser Verhältnis zur Pädagogik angeblich revolutionieren: Inverted Classroom, adaptives Lernen, KI-gestützter Unterricht, Virtual Reality… Diese Ansätze sehen jedoch nur auf dem Papier modern aus: Die zugrunde liegenden Prinzipien sind Bestandteil einer Tradition, die nicht erst gestern entstanden ist.
Dies lässt sich am Beispiel des Inverted Classroom sehr gut veranschaulichen. Die ursprüngliche Idee hatte den Anspruch, aus dem Rahmen zu fallen: Der Unterricht sollte nicht mehr vom Wissenserwerb geprägt werden, sondern von interaktiven Inhalten. Aber bereits im 18. Jahrhundert betonte Johann Heinrich Pestalozzi dass praktische Anwendung und Eigenverantwortung der Lernenden eine entscheidende Rolle spielen.
Digitale Tools, die Lernprogramme personalisieren sollten, sind eigentlich nur eine weitergehende Auslegung der Arbeiten von Maria Montessori ou Célestin Freinet, die sich für individuelle und aktiv gestaltete Bildungsinhalte stark gemacht hatten. Die neuen Technologien machen eine Skalierung der Lerninhalte besonders leicht und ändern unser Verhältnis zur Zeit – dies ist ihr eigentlicher Beitrag.
Seit Jahrhunderten nichts Neues unter der Sonne
Die Grundprinzipien der Pädagogik wie Beteiligung der Lernenden, Learning by Doing, Wiederholung und praktische Anwendung von Lerninhalten haben sich im Laufe der Zeit nicht verändert. Einige Ideen waren bereits zu Zeiten von Sokrates vorhanden, der seine Schüler mittels Mäeutik zu kritischem Denken anleiten wollte. Im 17. Jahrhundert betonte Comenius die Bedeutung eines unterhaltsamen Unterrichts, der sich außerdem am Alter der Lernenden orientieren sollte.
Im Laufe der Zeit sind natürlich neue Medien entstanden: Von Büchern, die den Zugang zu Wissen nach und nach demokratisiert haben, bis hin zu Tablets mit Touchscreen, die die physischen Begrenzungen von Lernmitteln auf Papier hinter sich lassen. Die Basis der Pädagogik hat sich jedoch nicht im Geringsten geändert. Es sind eher die technischen Mittel und die von der Gesellschaft geprägten Lernbedingungen, die sich geändert haben. So war in Frankreich Bildung traditionell einer Elite vorbehalten, die Privatunterricht erhielt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich jedoch eine Bildung für die breite Bevölkerung. Dies hat zu Veränderungen im pädagogischen Ansatz geführt, die nicht ignoriert werden können.
Entwicklung ja, aber vor allem in der Technologie
In den letzten Jahren wurde der Begriff „Innovation“ insbesondere mit einer Reihe von Technologien in Verbindung gebracht, die sich immer weiter entwickelt haben. Hierzu zählen erweiterte Tools für Videokonferenzen, Blockchain, Virtual Reality, Augmented Reality und natürlich die nicht zu vermeidende KI. Zwar vollbringen diese Tools keine Wunder, haben jedoch in einigen Anwendungsbereichen zu verblüffenden Ergebnissen geführt.
- In der Medizin können zukünftige Chirurgen mit einer Virtual-Reality-Brille Operationen in einer echt wirkenden Umgebung durchführen.
- Lehrkräfte können Unterrichtseinheiten in einem virtuellen Klassenzimmer abhalten, verschiedene Arbeitsgruppen einrichten und die Ergebnisse für die weitere Verwendung über Plattformen sichern.
- Über KI-gesteuertes adaptives Lernen können Lehrinhalte personalisiert werden – allerdings befinden wir uns hier noch in den Anfängen.
Die wahre Innovation liegt daher nicht in der Schaffung neuer pädagogischer Prinzipien, sondern in einer wirksamen Umsetzung der bisherigen Prinzipien dank technologischer Fortschritte und Entdeckungen der Kognitionswissenschaft. Was wir anstreben, ist folglich keine pädagogische Innovation, sondern eine technologische Innovation im Dienste der Pädagogik.
Innovation: eine Geisteshaltung
Abgesehen von diesen semantischen Präzisierungen muss Innovation auf der Unternehmensebene relativiert werden. Innovation kann einfach bedeuten, dass man mit bisherigen Gewohnheiten bricht. Die Digitalisierung des Bildungsangebots ist für einige Anbieter revolutionär, während der Markt schon viel weiter ist.
Innovation kann auch an einen bestimmten Kontext, eine Brache oder ein konkretes Publikum gebunden sein. So kann die Vermittlung von Lerninhalten etwa für Menschen mit Behinderungen über hybride Programme neu konzipiert werden.
Abschließend sollte noch betont werden, dass Innovation nicht unbedingt ressourcen- oder kostenintensiv sein muss. Die „frugale Innovation
zeichnet sich beispielsweise dadurch aus, dass Bedürfnisse möglichst effizient befriedigt werden, d. h. mit einfachen Lösungen und möglichst wenigen Mitteln. Angenommen, ein Unternehmen möchte auf dem B2B-Markt expandieren. Bei der hierfür erforderlichen Weiterbildung des Personals soll nicht der Projektleiter monolithische Inhalte präsentieren, sondern je nach Erfahrung der Mitarbeiter verschiedene Programmbausteine individuell einsetzen.
Innovation bleibt also ein Konzept mit flexibel einsetzbaren Variablen. Über dieses Thema könnte man noch stundenlang diskutieren – andere können das wohl viel besser als ich. Entscheidend ist meiner Meinung nach, dass man seiner Zielgruppe zuhört, seine eigene Praxis in Frage stellt und experimentierfreudig bleibt, denn ohne praktische Anwendung keine Innovation!